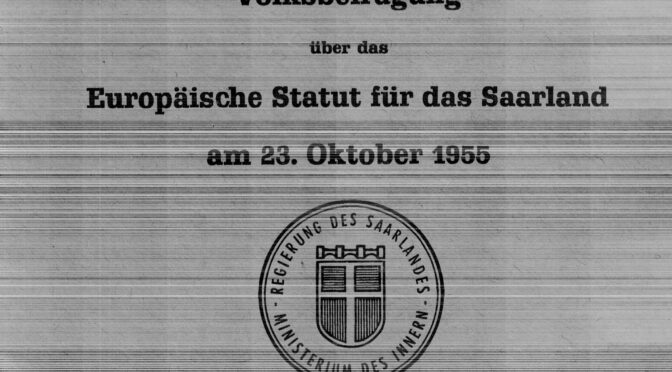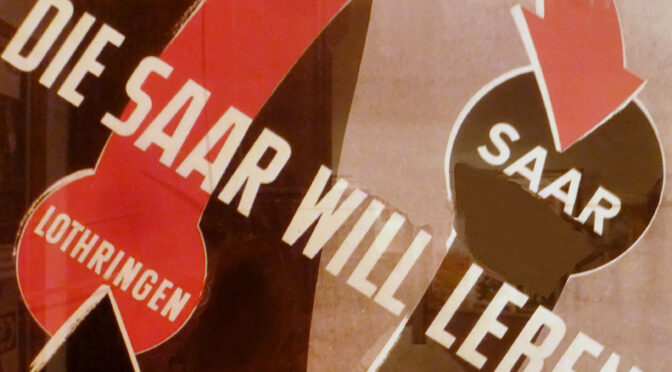Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai 1945 wurde Deutschland von den alliierten Siegermächten in Besatzungszonen aufgeteilt.
Das Saarland, das bereits nach dem Ersten Weltkrieg für mehrere Jahre unter Völkerbundmandat gestellt worden war, wurde erneut von Deutschland abgetrennt und der französischen Besatzungszone zugeschlagen.
Frankreich verfolgte dabei von Beginn an eine Politik, die darauf abzielte, das Saarland wirtschaftlich und politisch dauerhaft an sich zu binden. Die Motive dafür waren vielfältig:
Die Kontrolle über die riesigen Saar-Kohlevorkommen und die Stahlindustrie der Region war für den französischen Wiederaufbau von entscheidender Bedeutung.
Durch die Abtrennung einer wichtigen Industrieregierung wollte man ein wiedererstarkendes Deutschland schwächen und eine Pufferzone schaffen.
Die Nutzung der saarländischen Ressourcen wurde auch als eine Form der Reparation für die im Krieg erlittenen Verwüstungen angesehen.
Am 22. Dezember 1947 wurde diese Sonderstellung formalisiert. Das Saarland wurde aus der französischen Besatzungszone ausgegliedert und erhielt eine begrenzte politische Autonomie als eigenständiger „Saarstaat“ (offiziell: Saarland).
Die Verfassung des Saarlandes von 1947 garantierte zwar eine eigene Regierung unter dem Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann, doch die Realität war eine starke wirtschaftliche und außenpolitische Abhängigkeit von Frankreich:
Die Saar-Wirtschaft wurde in das französische Währungs- und Zollsystem integriert (Franc-Währung).
Frankreich übernahm die Vertretung der saarländischen Interessen im Ausland.
Diese enge Bindung war in der saarländischen Bevölkerung von Anfang an umstritten. Viele Saarländer fühlten sich kulturell und historisch Deutschland zugehörig und lehnten den Sonderstatus als Fremdbestimmung ab.
In den frühen 1950er Jahren suchten Frankreich und Deutschland nach einer Lösung für die „Saarfrage“. Der französische Ministerpräsident Pierre Mendès France und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer entwickelten einen Kompromiss: das sogenannte Europäische Statut.
Dieser Plan sah vor, das Saarland nicht einfach an Deutschland zurückzugeben, sondern unter die Aufsicht einer europäischen Institution zu stellen, der West europäischen Union (WEU). Es sollte zu einer Art „europäisiertem“ Territorium werden, mit eigener Regierung, aber wirtschaftlich an beide Nachbarn angebunden. Für viele schien dies ein wegweisendes Modell für die junge europäische Integration zu sein.
Über dieses Statut wurde am 23. Oktober 1955 eine Volksabstimmung im Saarland abgehalten. Das Ergebnis war eine klare und für die Befürworter überraschende Absage: 67,7 % der Wähler stimmten dagegen.
Die Ablehnung hatte mehrere Gründe:
Der Wunsch, vollständig und ohne Einschränkungen zur Bundesrepublik Deutschland zurückzukehren, war in der Bevölkerung sehr stark.
Misstrauen gegenüber dem Statut: Viele Saarländer fürchteten, dass das Statut lediglich die französische Vorherrschaft in einem europäischen Mäntelchen fortsetzen würde, ohne echte Selbstbestimmung zu gewähren.
Der wirtschaftliche Aufschwung im „Wirtschaftswunderland“ Bundesrepublik war attraktiver als die weiterhin enge Bindung an Frankreich.
Die deutliche Ablehnung des Europäischen Statuts durch die Bevölkerung ließ keinen Raum für andere Interpretationen. Frankreich akzeptierte den demokratischen Willen der Saarländer.
In der Folge wurden die Saarverträge („Vertrag von Luxemburg“) ausgehandelt, die die Rückgliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik Deutschland zum 1. Januar 1957 regelten.
Wirtschaftlich vollzog sich die Rückkehr jedoch erst später: Am 6. Juli 1959 („Tag X“) wurde die D-Mark offizielles Zahlungsmittel im Saarland und löste den Französischen Franc ab.